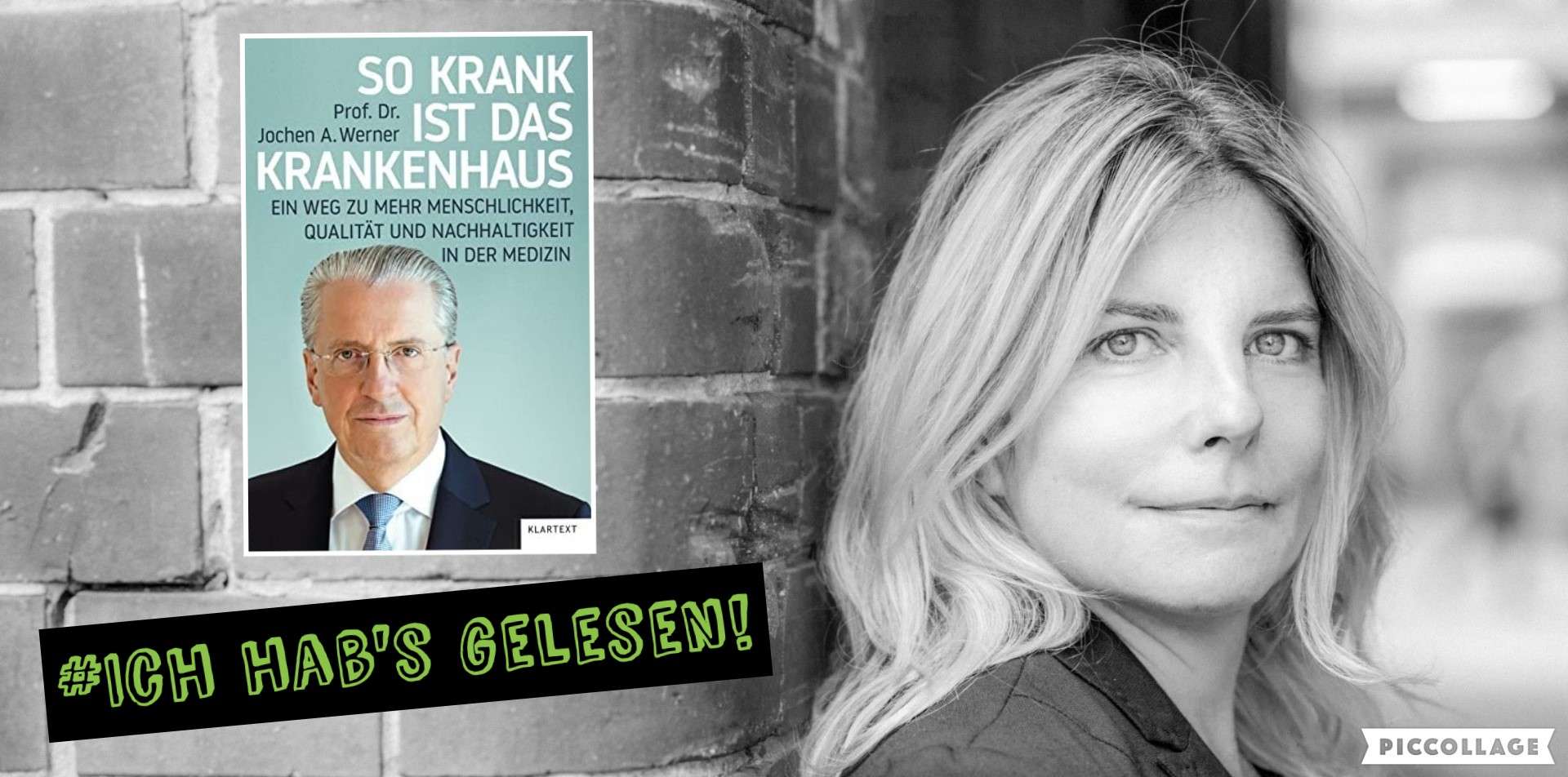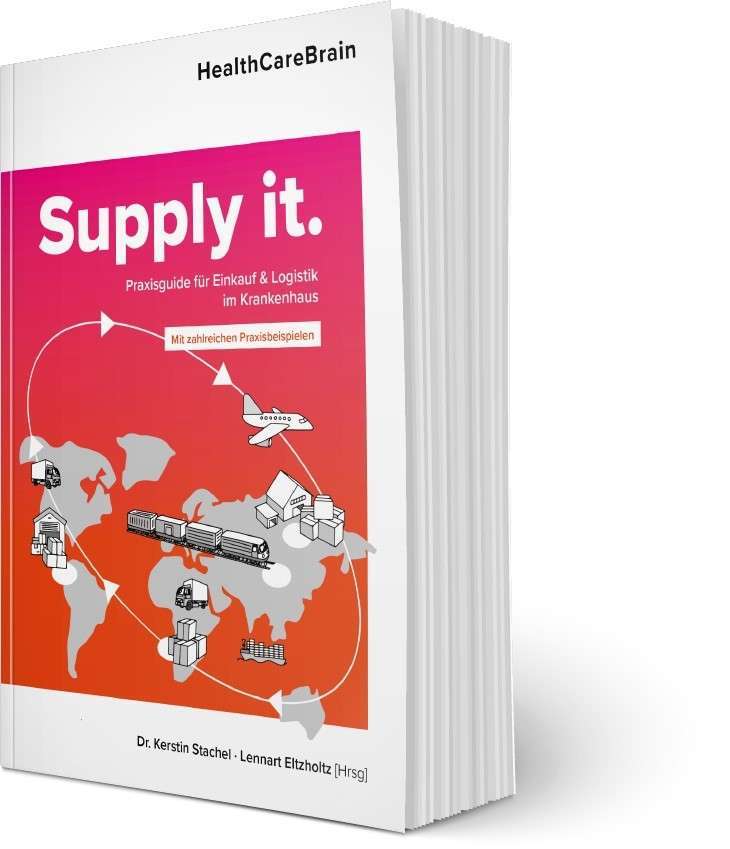Rezension zum Buch von Herr Prof. Werner
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem gelungenen Buch und große Bewunderung für Sie und das Team an der #Universitätsmedizin Essen.
Ich habe Ihr Buch von Anfang bis Ende mit Spannung gelesen. Mein Fazit: Ich finde es sehr mutig, wie sie unbequeme Dinge offen aussprechen. Ich bin begeistert von den zahlreichen innovativen Ideen und konstruktiven Lösungsansätzen und Praxisbeispielen.
Nach 14 Jahren in unterschiedlichen Managementpositionen an den #Unikliniken Bonn und Magdeburg kann ich Ihrer Analyse, dass „das größte Problem im Smart Hospital die leitenden Ärzt*innen (S: 192) sind,“ nur zustimmen. Würden in Unikliniken tatsächlich alle Berufsgruppen an einem Strang ziehen, dann könnten die Unikliniken in Deutschland eine Innovationskraft mit maximaler Sogwirkung für das Gesundheitswesen entfalten.
Sie haben ebenso recht, wenn Sie schreiben, dass die massiv einschränkenden Rahmenbedingungen des #Gesundheitswesens dazu führen, dass sich das #Krankenhausmanagement mit Dingen wie: Krankenhausplanung, Fallpauschalen und Fixkostendegressionsabschlag beschäftigt. Begriffe wie Synergien, Digitalisierung, Agilität oder Interaktion hingegen hört man im Krankenhausmanagement kaum. Die Medizin kocht traditionell nach wie vor zu sehr im eigenen Saft. „Das liegt unter anderem, an diesen hochkomplexen, die Kreativität massiv einschränkenden, Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten. Im DRG-Vergütungssystem werden Fortschritt und das Beschreiten neuer Wege nicht belohnt, sondern zunächst durch Nicht-Finanzierung bestraft.“ (S. 351)
Für alle, die „noch nicht“ die Zeit gefunden haben ein Blick in das Buch von Herrn Prof. Dr. Jochen A. Werner zu werfen, hier ein kurzer Überblick über meine wichtigsten Take-Home-Messages.
Zunächst was ist ein Smart Hospital? Das #SmartHospital ist absolut patientenorientiert und „ist das Kernstück des reformierten Gesundheitssystems, eine Steuerungsplattform, die nicht an den Krankenhausmauern endet, sondern ohne Unterbrechung mit den weiteren Sektoren des Gesundheitswesens vernetzt ist. Es ist Systemkopf und Schaltzentrale (S. 23).“
Im Buch finden sich umfangreiche Überlegungen, untermauert mit zahlreichen Praxisbeispielen, wie ein Smart Hospital konkret ausgestaltet werden muss und welche praktischen Maßnahmen die Universitätsmedizin Essen bereits umgesetzt hat.
Smart Hospital in Stichworten:
Healing Environment, Kommunikation und Service, Patient*innenerleben, Umgang mit Beschwerden, Wohlbefinden der #Patient*innen, Dialog zwischen Patient*innen, Avatarkrankenhaus, Würde des Menschen, Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, empathische Kommunikation, Nächstenliebe und Hilfestellung, Patientensicherheit, schmerzfreies Krankenhaus, Fehlerkultur, innovative Ideen zur Schulung von Situationsbewusstsein, Informationsfluss zwischen den Sektoren, Nachsorge durch die Digital Nurse, Patient*innenrechte, Digitales Empowerment, Patient*innenqualifikation, Gesundheit als Pflichtfach in allen Schulen, Empowerment der Patient*innen, Nutzung von Daten zum Wohle des Patienten und zur Verbesserung der Wissenschaft, Prävention als Game Changer des Gesundheitssystems.
Vernichtend fällt die Analyse zum aktuellen „Gesundheits“-zustand des Gesundheitswesens aus und die Analogie mit der Schweizer Präzisionsuhr trifft es wie die Faust aufs Auge:
„Über die Jahrzehnte leierte die Unruhe im Uhrwerk aus, die Zahnräder waren teilweise abgeschliffen, teilweise miteinander verschränkt. Eine solche Mechanik lässt sich irgendwann nicht mehr an der höchsten Präzision orientiert reparieren. Sie würde die ursprüngliche Genauigkeit niemals zurückgewinnen. (Seite 16)
Damit geht es aktuell um einen Systemwechsel im Gesundheitswesen, um einen Austausch: analoges Werk raus, digitales System rein.
Was muss geschehen, um diesen Systemwechsel im Gesundheitswesen zu vollziehen? Was sind die Hindernisse?
Zunächst braucht es für die Medizin von Morgen einen neuen Typus Mensch: offen, selbstkritisch, ausschließlich am Wohl der Menschen und deutlich weniger an der persönlichen Reputation interessiert (S.146). Derzeit wird das Gesundheitswesen von Partikularinteressen bestimmt (S. 90) und orientiert sich nicht an den objektiven Aufgaben, die gelöst werden müssen. Der Patient hat kein oder wenig Mitspracherecht (Beispiel Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)). Prof. Werner schreibt: „Im Gesundheitssystem wird in alter Tradition über die Kund*innen bestimmt, sowie früher die Ärzt*innen ohne Widerspruch zu dulden, festgelegt haben, welche Therapie erfolgen soll. Das ist altes Denken, das die Erneuerung des Gesundheitssystems erschwert (S. 91).
Auf dem Weg zur Digitalisierung verhindert der Datenschutz die Anwendung von bereits vorhandenen Methoden und Techniken des Smart Hospitals. Herr Prof. Werner findet kernige (und aus meiner Sicht absolut treffende Worte), um den deutschen Datenschutz zu beschreiben: „German-Angst-Datenschutzsystem“, #TODDURCHDATENSCHUTZ.
Gefallen hat mir auch das Wort „Humane Blockadekräfte“. Ich habe immer wieder erfahren müssen, wieviel Zeit und Energie es kostet in diesem hochkomplexen Gesundheitssystem alle mitzunehmen und manchmal gelingt es einfach nicht und es wird weitergewurschtelt.
Woran liegt es? Im Buch findet sich eine umfangreiche, tiefgründige und scharfe Analyse:
- Das Instrumentarium unternehmerischen Handelns in Krankenhäusern ist limitiert. Ursache dafür sind die umfangreichen Regularien.
- Alle Einrichtungen stehen unter einem immensen Druck die wirtschaftlichen Ziele der Eigentümer zu erreichen. Dieser Leistungsdruck muss und wird an die Chefärzte weitergegeben. Die Chefärzte haben teils eine verzerrte Wahrnehmung und ihr Machtstreben und persönliche Eitelkeiten erschweren effektives Arbeiten. Herr Prof. Werner zitiert aus einem Dialog mit Chefärzten: „Der Kaufmann hat uns zu dienen.“
- Die Chefärzte sitzen am längeren Hebel, denn im Regelfall haben sie unbefristete Verträge. Das Management aber befristete Verträge. Besonders ungünstig ist es, wenn der ärztliche Direktor seine Aufgaben im Nebenamt wahrnimmt und es damit zu Interessenkonflikten kommt.
- Ein bewährtes Instrument der Chefärzte sich gegen Leistungsdruck zu wehren ist dann die Destabilisierung der Krankenhausgeschäftsführung. Auf S. 163 ff beschreibt Prof. Werner absolut brillant die Mechanismen der Methode: „Geschäftsführer weg und es kehrt Ruhe ein.“
Herr Prof. Dr. Jochen A. Werner beschreibt die besondere Gemengelage zwischen Management und Chefärzten mit sehr viel Wertschätzung und Praxiserfahrung. Auf S. 183 heißt es: „Die allermeisten Chefärzte*innen, die ich in meiner nun über 40-jährigen Krankenhauserfahrung aus den unterschiedlichsten Positionen heraus erlebt habe, verrichten hervorragende Arbeit. Aber es gibt auch andere. Toxiker*innen, die eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und keinen Platz haben dürfen in einem System so sehr an der Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen Freude und Trauer, zwischen Stabilität und Fragilität. Einem System, das von der Menschlichkeit der einen genauso geprägt wird, wie von den Eitelkeiten und dem Machtstreben der anderen. Toxiker*innen gehören rechtzeitig identifiziert und aus dem Krankenhaus entfernt.
Es geht um das Wohl der Patienten*innen. Hier muss das Verhalten der Führungskräfte durch Anstand, Ehrlichkeit und Wertschätzung geprägt sein. Die Aufsichtsräte müssen weiter professionalisiert werden. An den Unikliniken ist ein stimmberechtigtes Einbinden des ärztlichen Direktors in das Berufungsverfahren unverzichtbar (S. 185).
Herr Prof. Dr. Jochen A. Werner wirbt für eine Offensive gegen den Pflegenotstand (Die Zeit drängt sehr!).
Folgende Punkte sollten adressiert werden:
- bessere Bezahlung
- der Verzicht auf Zeitarbeit
- eine gesicherte gesteigerte gesellschaftliche Akzeptanz,
- das Schaffen von Perspektiven zur Weiterentwicklung mit fortschreitender Berufsdauer, mehr Durchlässigkeit des Ausbildungsbereichs zum Beispiel für medizinische Fachangestellte
- Wertschätzung innerhalb des Krankenhausteams
Zur Finanzierung von Krankenhäusern schreibt Herr Prof. Dr. Jochen A. Werner: „Das Krankenhauswesen steht am ökonomischen Abgrund (S. 313)“.
Dies leitet sich aus der abnehmenden Ertragskraft bei gleichzeitig steigenden Kosten ab.
Gründe für die Kostensteigerung:
- steigenden Bau- und Betriebskosten
- unausweichliche Investitionen in die Digitalisierung und Nachhaltigkeit
- Einstellungsinitiativen von Pflegepersonal
- nicht gegenfinanzierte steigende Personalkosten
Wie kann dies gelöst werden? Antwort: Durch eine Parallelität von Strukturreformen und Digitalisierung.
Ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass es scheinbar möglich ist, mit der Hälfte der Krankenhausbetten auszukommen, ohne die Lebenserwartung der Menschen negativ zu beeinflussen. Unter Expert*innen ist es unstrittig das mittel- und langfristig mindestens ein Drittel der Häuser geschlossen, zusammengelegt oder umstrukturiert werden müssten.
Die klare Forderung: #Gesundheitspolitik und vor allem die Bedarfsplanung bei Krankenhäusern darf nicht länger Lokalpolitik sein. Mit der Illusion, dass Häuser der Grundversorgung eine Notfallversorgung für die Patient*innen erbringen können, muss gebrochen werden. Notfallmedizin muss als spitzenmedizinische Versorgung zentralisiert werden, damit mehr Menschen überleben. Notwendig ist ein bundespolitischer oder zumindest landespolitischer Masterplan, ohne persönliche Betroffenheiten von einer übergeordneten Leitwarte, nach rein sachlichen Kriterien gesteuert. Die zentralisierte Steuerung ist Grundvoraussetzung dafür, häufig vorhandene Über- und Unterversorgung von Regionen zu nivellieren und die Qualität der medizinischen Versorgung bundesweit hoch und bezahlbar zu halten. Apotheken könnten zum systemrelevanten HUB werden.
Die Neustrukturierung des Gesundheitswesens brauch zudem definitiv Züge und Einbindung des Unternehmertums. Die Behandlung (eines Patienten*in) darf nicht durch das Vergütungssystem bestimmt werden.
Zum Abschluss noch, die für mich wichtigsten, Botschaften aus dem Schlusskapitel:
- Wir können das Gesundheitssystem nicht reformieren, ohne das Land zu reformieren.
- Veränderungen brauchen harte Arbeit, Durchsetzungs- und Umsetzungsvermögen. Tugenden, die in Deutschland in Vergessenheit geraten zu scheinen.
- Die Medizin von morgen braucht neue Denkstrukturen, sie braucht Emotionalität und Begeisterung und den Willen zur Leistung und Veränderung.
- Wir müssen umsetzen, statt zu diskutieren, wir müssen unsere Angst ablegen.
- Wir müssen hin zu einem neuen anderen Leistungsgedanken: Leistung muss aus dem Wunsch erwachsen dem Menschen wirklich helfen zu wollen. Das Gesundheitssystem menschlicher und nachhaltiger zu gestalten und Menschen gesund zu machen, gesund zu halten und die Erde zu einem lebenswerten Ort zu machen. Ein solcher Leistungsgedanke bedeutet einen Paradigmenwechsel, einen Mentalitätswandel in unserer Gesellschaft. #Gutmenschentum2.0 sozusagen.
Ich kann nur sagen: Ich bin dabei. Packen wir es an. Wenn wir es nicht tun, wird es keiner tun.
Danke für die inspirierende und mutmachende Lektüre!